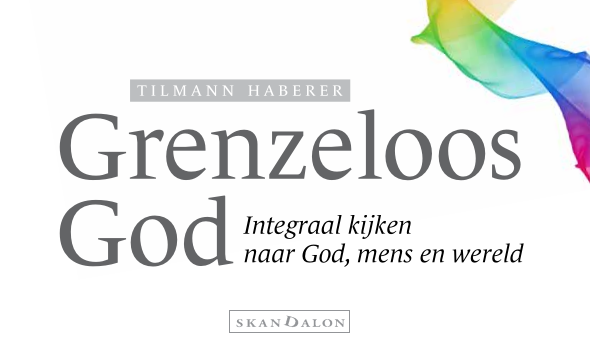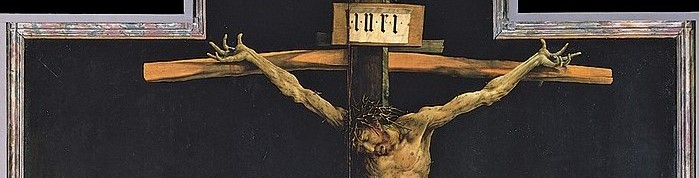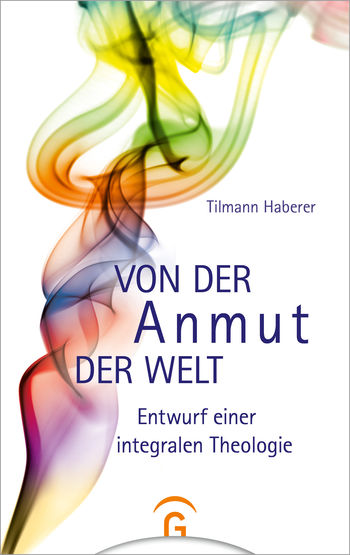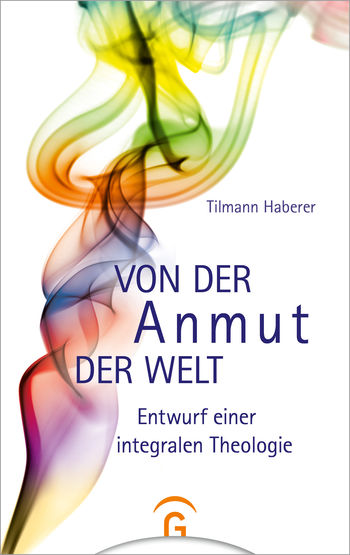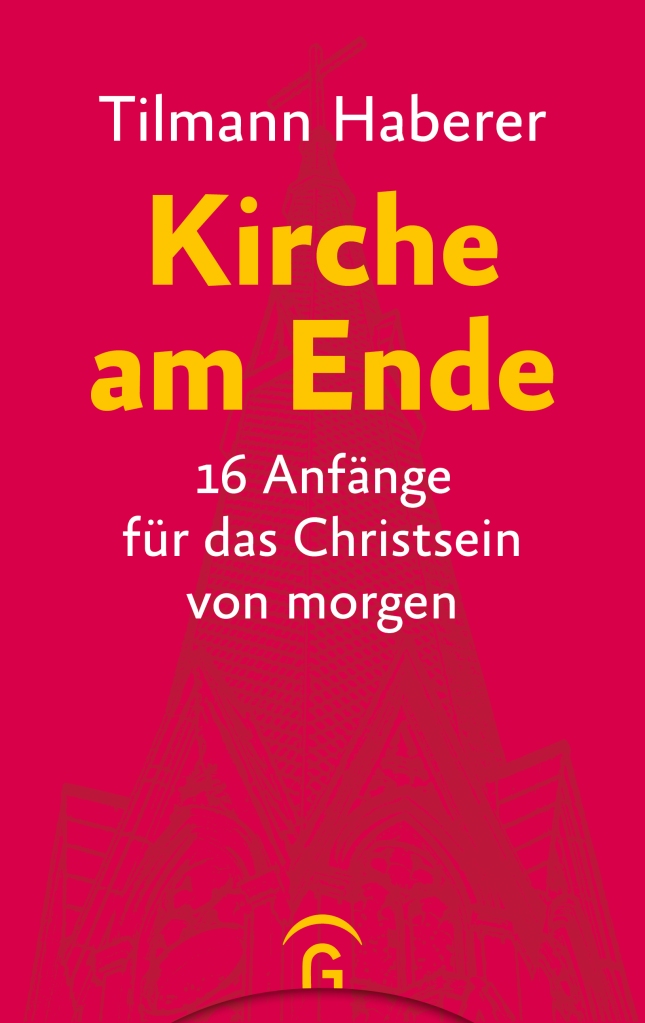
Am 4.Oktober habe ich mein neues Buch vorgestellt, im Rahmen einer Veranstaltung, an der auch der künftige Landesbischof der bayerischen Landeskirche, Christian Kopp, teilgenommen hat.
Hier teile ich die Rede, die ich zur Einführung gehalten habe.
Kirche am Ende
Buchpräsentation am 4. Oktober 2023
Liebe Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,
„Die aktuellen Zahlen zu den Kirchenaustritten haben nun auch den Letzten die Augen geöffnet. Wenn nahezu eine Million Menschen im Jahr 2022 die großen christlichen Kirchen in Deutschland verlassen haben, dann ist klar: Die Epoche der Volkskirche ist definitiv zu Ende.“ Diese Sätze stammen nicht von mir, sondern von Jörg Lauster, der vielen hier ein Begriff sein dürfte – Professor für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät hier an der LMU. Aus der Zeitschrift Publik-Forum vom 25. August dieses Jahres.
Ich zitiere Jörg Lauster, weil ich in seinen Sätzen einen Beleg dafür sehe, dass viele Menschen in unserem Land – möglicherweise auch hier im Raum – diese Diagnose teilen. Es gibt uferlos viel Literatur dazu. Aber darum geht es in meinem Buch gar nicht, keine Diagnose, kein Volkskirchen-Bashing, keine Verbesserungsvorschläge. Sondern? Dazu kommen wir gleich.
Bevor ich tiefer in das neue Buch einsteige, möchte ich Ihnen erzählen, wie ich dazu gekommen bin, gerade dieses Buch zu schreiben.
Vor zweieinhalb Jahren, im Mai 2021, erschien mein Buch „Von der Anmut der Welt. Entwurf einer integralen Theologie“. Darin habe ich sozusagen meine persönliche Summa Theologica aufgeschrieben. Ich gehe die „Hauptstücke“ der christlichen Theologie durch, wie in einem Dogmatik-Lehrbuch. Als Denkrahmen benutze ich das integrale Weltbild – eine Art zu denken und zu glauben, die scheinbar Unvereinbares als Paradox verstehen kann und in der Lage ist, scheinbare und auch echte Widersprüche stehen zu lassen. Diese Sichtweise ermöglicht zum Beispiel einen völlig neuen Blick auf die altkirchlichen Dogmen, die Trinität und die Zwei-Naturen-Lehre.
In diesem Buch streife ich die Kirche nur am Rande. Aber bald wurde mir klar, dass ich auch der Frage nachgehen will – ja: muss –, was dieses theologische Denken für die Sozialgestalt des Christentums bedeutet, also für die Kirche. Ich nahm mir vor, ein Buch über integrale Kirche zu schreiben.
Die Idee war, dass sich die Kirche im integralen Bewusstseinsraum oder im integralen Mindset radikal wandeln muss. Es geht nicht mehr an, ein paar Veränderungen im Erscheinungsbild vorzunehmen – neue Gottesdienstformen und neue Gottesdienstzeiten, eine hippe Sprache, vielleicht sogar ein bisschen Worship-Musik. Es braucht eine grundlegende Transformation. Dietrich Bonhoeffer fiel mir wieder mal ein. Die Sätze aus dem „Entwurf einer Arbeit“, einer Arbeit, die Bonhoeffer leider nicht mehr schreiben konnte, haben sich in mein Gedächtnis gebohrt und hallen in meinem Geist nach, seit ich sie Ende 1977 im Zug von Heidelberg nach Coburg gelesen habe:
„Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist.“
Wie oft habe ich mich während meiner Zeit als Gemeindepfarrer gefragt, ob wir denn wirklich für andere da sind. Ob das, was wir tun, nicht eine einzige Selbstbeschäftigungsmaschinerie ist. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Das galt sicher nicht nur gegen Ende des 2. Weltkriegs und der Nazi-Herrschaft. Das gilt gestern, heute und morgen.
Aber dann schreibt Bonhoeffer ja weiter: „Um einen Anfang zu machen, muss sie [die Kirche] alles Eigentum den Notleidenden schenken. Die Pfarrer müssen ausschließlich von den freiwilligen Gaben der Gemeinden leben, evtl. einen weltlichen Beruf ausüben. Sie muss an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern helfend und dienend.“
Diese Worte haben mich begleitet und immer wieder eingeholt. Und wer weiß, vielleicht standen sie auch Pate bei meinem Entschluss, mich aus dem kirchlichen Dienst beurlauben zu lassen ohne irgendeinen Plan, wovon ich leben will – und kann. Es wurden sieben Jahre, in denen ich mir die Brötchen in einem weltlichen Beruf verdiente, wie ich es bei Bonhoeffer gelesen hatte. Und der Entschluss, mich dann auf die freie Stelle bei der Münchner Insel zu bewerben, hatte zentral damit zu tun, dass die Münchner Insel einer der Orte ist, an denen Kirche wirklich unzweifelhaft für andere da ist.
Ich wollte also diese Transformation beschreiben, die ich für notwendig halte. Aber die Realität holte mich immer wieder ein. Die parochialen Egoismen, an denen wir uns in der Münchner Innenstadt bald jahrzehntelang abgearbeitet haben und nicht einmal einen gemeinsamen Gemeindebrief zustande bekommen haben. Die fest zementierten Formen, Formate und Zeiten. Die unverrückbare Zentralstellung des Sonntagsgottesdienstes als „Mitte der Gemeinde“, die Bürokratie auf allen Ebenen. Ich will es nicht weiter ausmalen, jede und jeder in diesem Raum dürfte es kennen.
Ich war nahe daran zu verzweifeln. Ich kann Bücher schreiben, so viele ich will – und nebenbei bemerkt, es wäre ja beileibe nicht das erste Buch, das eine grundlegende Transformation der Kirche zum Thema hat –, ich könnte also Bücher schreiben, so viel ich will, ich selbst habe es ja in meinen 18 Jahren in drei verschiedenen Gemeinden, davon 13 Jahre hier in St. Lukas, auch nicht geschafft, grundlegende Änderungen herbeizuführen. Es wird sich nichts ändern. Die Kirche ist wie ein Ozeanriese, der auf Kurs läuft und diesen Kurs nur sehr, sehr langsam und mit einem unendlich weiten Wenderadius verändert werden kann. In den letzten zwei, drei Jahren geht vielleicht ein bisschen was voran, dank PuK-Prozess und Freiburger Studie. Aber ein Buch über die grundlegende Transformation der Kirche, wie ich es ursprünglich im Sinn hatte, konnte ich nicht mehr schreiben.
***
Nun hatte ich aber doch schon einiges gelesen und recherchiert. Und ich machte dabei aufregende Entdeckungen. Ich warf mein Konzept um. Kein ekklesiologischer Entwurf, sondern ein empirischer Ansatz. Ich beschloss, zu beschreiben, was ich sehe.
Je länger ich nämlich suchte und herumlas, desto häufiger stieß ich auf Initiativen, Gruppen und Grüppchen, Gemeinschaften und Projekte, die es außerhalb der volkskirchlichen Strukturen und Förderrichtlinien, unabhängig von irgendeiner Konfession unternahmen, ihr Christsein gemeinsam zu leben. Und sehr häufig waren diese Initiativen verbunden mit sozialdiakonischen Aktivitäten. Kirche für andere. Ich denke dabei nicht an die klassischen, großen Neugründungen wie ICF oder Hillsong. Ich habe viele kleine und größere Initiativen gefunden, zum Beispiel:
- kleine Kreise mit einer Handvoll Leuten, die sich zur Meditation oder zum Gebet und zur Obdachlosenspeisung treffen,
- Online-Communities, die miteinander unterwegs sind, obwohl ihre Mitglieder teils hunderte von Kilometern auseinander wohnen,
- Lebensgemeinschaften von Menschen, die ganz bewusst und gezielt in einen sozialen Brennpunkt ziehen – nicht um die Menschen dort zu missionieren, sondern im mit den „Geringsten unter den Schwestern und Brüdern“ einfach zu leben. Und dann, nach einer geraumen Zeit des Kennenlernens und Zuhörens, entwickeln sie Projekte wie Hausaufgabenhilfe, Theaterprojekte, einen Mittagstisch oder Sozialberatung.
Und vieles, vieles andere. Das Spannendste daran: Viele dieser Initiativen stehen finanziell vollständig auf eigenen Füßen. Ob es die Meditationsgruppe ist, die sich im Wohnzimmer oder online zusammenschließt und damit gar keine Kosten hat, ob es ein Social Coworking-Space ist, der sich mit allerlei kommunalen Fördergeldern, EU-Mitteln, Sponsoren und privaten Spendern finanziert – bis hin zu großen Wirtschaftsbetrieben wie etwa dem Benediktushof Holzkirchen (Grüße an Doris und Frieder Zölls), der als GmbH organisiert ist und sich wirtschaftlich vollkommen selbst trägt. Und warum auch nicht: Macht es so nicht jeder Sportverein?
Und dann stieß ich bei meinen Recherchen wieder auf das Bild vom Ozeandampfer, doch mit einer überraschenden und aufregenden Wendung. Hier möchte ich Ihnen jetzt aus dem Buch vorlesen, den Anfang des 5. Kapitels [76f.].
5. Das Christentum von morgen lebt in einer bunten Vielfalt an Formen, die sich auch immer wieder ändern können.
Am 14. April 1912 gegen 23:40 Uhr machte der Matrose Frederic Fleet eine fatale Entdeckung: „Eisberg voraus!“, rief er in sein Telefon. Doch es war zu spät. Schon rammte die Titanic das eisige Hindernis, zwei Stunden später war der Riesendampfer untergegangen. 1.514 Menschen fanden den Tod.
Wenn Menschen über die Zukunft der Volkskirche sprechen, wird die Titanic immer wieder einmal als Gleichnis ins Spiel gebracht: ein Koloss, zu groß für rasche Ausweichmanöver, der unausweichlich auf den Untergang zusteuert, während im Salon das Orchester spielt und die Stewards die letzten Drinks servieren. Die Rolle von Frederic Fleet, dem Mann im Ausguck, wird bei solchen Gesprächen in letzter Zeit oft der Freiburger Studie aus dem Jahr 2019 zugeschrieben. Diese Studie prognostiziert, dass sich bis 2060 sowohl die Zahl der Kirchenmitglieder als auch die Höhe der Kirchensteuereinnahmen halbiert haben werden.
Ob diese Entwicklung tatsächlich der Eisberg ist, der den Ozeanriesen namens Kirche (in Deutschland) in den Untergang rammt, sei dahingestellt. Mir kommt es bei dem Vergleich mit der Titanic auf etwas anderes an. In dem schon erwähnten Podcast aus der Reihe „ausgeglaubt“ mit Heinzpeter Hempelmann taucht das Titanic-Bild ebenfalls auf. Stephan Jütte, einer der beiden Hosts des Podcasts, entwirft eine rettende Fantasie: „Es könnte auch sein, dass du noch ganz knapp vor dem Eisberg stehst und weißt: Das Schiff wird in den Eisberg hineinfahren und es wird sinken. Aber du rennst dann quasi zum Käpt’n und sagst: Hey, wenn wir jetzt die Rettungsboote rauslassen, dann kriegen wir sie alle irgendwie noch weg. Aber das würde dann eben heißen, dass verschiedene Leute verschiedene Boote brauchen und der große Dampfer nicht mehr funktioniert.“
Verschiedene Boote. Dieses Bild gefällt mir. Es scheint mir gut zu charakterisieren, was Kirche von morgen sein kann: Der große Dampfer funktioniert nicht mehr. Doch selbst wenn er untergeht, wenn also die Volkskirchen von der Bildfläche verschwinden, wären Menschen weiterhin auf dem Ozean unterwegs. Nun eben in kleinen Booten. Und ich greife das Wort von den „verschiedenen Booten“ auf und stelle mir vor: Neben den „offiziellen“ Rettungsbooten gibt es alle möglichen Kähne, Kanus, Flöße, Kajaks, Luftmatratzen, Jetski, Schwimmnudeln, Feluken, Ruderboote, Jollen, U-Boote, Kutter, Kanadier, Schlauchboote, Barken, Einbäume, Gondeln, Pinassen, Tretboote und Dingis, kleine und große, mit Segeln, Rudern oder Außenbordmotor, manche hochseetauglich und andere fragil und zerbrechlich – von Uniformität keine Spur. In allen sind Menschen unterwegs, alle schippern auf dem einen großen Strom namens Leben, angetrieben von der heiligen Geistkraft, die sich als Bootsdiesel, als Rückenwind oder als Stärkung für erschlaffte Muskeln präsentieren kann und will.
***
Im dritten und letzten Teil dieses Vortrags will ich drei Begriffe ins Zentrum stellen, die im Blick auf das Christentum von morgen wichtig sind.
Der erste Begriff ist ein Begriffspaar: postevangelikal und Dekonstruktion. Mir ist aufgefallen, dass die Träger und Mitglieder etlicher Initiativen und Gemeinschaften, die ich anführe, aus einem evangelikalen, pietistischen oder freikirchlichen Hintergrund kommen. Gerade für Menschen in Freikirchen ist diese Selbständigkeit, diese Entrepreneur-Haltung eine Selbstverständlichkeit. Eins aber fehlt bei allen, mit denen ich gesprochen habe, deren Podcasts ich gehört und von denen ich gelesen habe: es fehlt die Exklusivität und Enge, die man landläufig mit dem Stichwort „evangelikal“ verbindet. Immer wieder war ich verblüfft über die geistige und geistliche Weite, der ich begegnet bin. Viele dieser Menschen bezeichnen sich selbst als post-evangelikal. Nicht ex-evangelikal, denn sie verstehen sich immer noch als Nachfolger Jesu. Aber sie haben das strenge, enge, exklusive, das strafende Gottesbild hinter sich gelassen und freuen sich an Gottes Weitherzigkeit, an Gottes Liebe zu allen Gotteskindern, egal welcher Konfession oder Religion, welcher sexuellen Orientierung, welcher Hautfarbe oder Nationalität. Hier kommt die andere Hälfte meines Begriffspaars ins Spiel: Dekonstruktion. Diese Christinnen und Christen haben einen Prozess der Dekonstruktion bestimmter Glaubensinhalte durchlaufen. Insbesondere die Sühnetod-Theologie haben die meisten von ihnen radikal dekonstruiert. Sie sind offen für panentheistische Sichtweisen, für Prozesstheologie und für ein ganz neues Verständnis der Trinitätslehre, das ihnen hilft, Gott in der Schöpfung, in den Mitmenschen und in sich selbst zu finden.
So müssen sie nicht mehr andere missionieren in dem Sinn, dass diese anderen genau die Art zu glauben und zu leben übernehmen müssen, wie sie in der Herkunftskirche herrschen. Und damit kommen wir direkt zum zweiten Begriff: missional. Ich mache es sehr kurz und damit sicher auch verkürzt, aber wir wollen ja auch Zeit zum Diskutieren haben. Unter Mission verstehe ich eine Haltung, die darauf abzielt, Gott zu den Menschen zu bringen. Johann Flierl, der klassische bayerische Missionar, fuhr zu den Papuas nach Neuguinea, um ihnen Gott beziehungsweise Jesus Christus zu bringen. Schon sprachlich ist in diesem Satz Gott ein Objekt. Die missionale Haltung dagegen geht davon aus, dass Gott nicht Objekt der Mission ist, sondern Subjekt. Gott wirkt. Und vor allem: Gott ist schon da, lange bevor der Missionar ankommt. Das heißt als Konsequenz: Die missionale Haltung ist zuallererst eine hörende. Wir erforschen, wie Gott schon wirkt an dem Ort, an den wir kommen. Wir nehmen die Erfahrungen unseres Gegenübers ernst, auch die spirituellen oder gar nicht bewusst spirituellen Erfahrungen und Fragen, und wir sind bereit, von den Menschen zu lernen. Wir sind auf gleicher Augenhöhe. Diese wohltuende Haltung ist mir landauf, landab bei den Initiativen und Gemeinschaften begegnet, die ich beschreibe.
Und schließlich der dritte Begriff: Arkandisziplin, vom lateinischen arcanum, geheim. Ursprünglich stand dieser Begriff dafür, dass in der frühen Kirche diejenigen, die Anschluss an die christliche Gemeinde suchten, aber noch nicht getauft waren, vor Beginn der Eucharistiefeier weggeschickt wurden. Die Eucharistie wurde als Geheimnis verstanden, das sich nur denen öffnete, die durch die Taufe initiiert waren. Ich benutze diesen Begriff wieder unter Rückgriff auf Dietrich Bonhoeffer, wobei mir bewusst ist, dass ich Bonhoeffers Idee nicht ganz genau wiedergebe. Was ich mit Arkandisziplin meine, ist dies: Viele der Menschen, mit denen ich gesprochen und von denen ich gelesen habe, haben für sich eine spirituelle Praxis, etwa ein intensives Gebetsleben. Aber sie hängen diese spirituelle oder geistliche Praxis nicht an die große Glocke. Und hier lese ich noch einmal einen kurzen Abschnitt aus meinem Buch [247f.]: Sie gehen damit „nicht hausieren und richten sich nicht an die große Öffentlichkeit. [Ein Zitat von Rainer Ebeling] ‚Anbetung und Lob Gottes praktizieren die Christen im Verborgenen und nicht als Demonstration der religiösen Macht in der Öffentlichkeit.‘ Sie pflegen die spirituelle Übung, um sich immer wieder an die Quellen ihres Glaubens anzuschließen, das gemeinsame Gebet wird zur geistlichen ‚Tankstelle‘ für die Mitarbeitenden. Dabei ist die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen wie im frühen Christentum und wie es Bonhoeffer zu seiner Zeit möglicherweise im Sinn hatte. Gäste sind jederzeit willkommen. Aber es gibt keine Werbung, vielleicht nicht einmal einen Aushang, keine ausdrückliche Einladung zu Gebet und gottesdienstlicher Feier.
‚Lasst uns lernen, eine Zeitlang ohne Worte das Rechte zu tun‘, schreibt Dietrich Bonhoeffer an anderer Stelle. Ohne Worte, das heißt für ihn aber nicht, dass er auf das Gebet verzichtet hätte, im Gegenteil. Gerade das gemeinsame Gebet war Bonhoeffer ein zentrales Anliegen. Es geht um das öffentliche Wort, vor allem um moralische Anweisungen oder Vorschriften, aber auch um autoritative Angebote der Weltdeutung, auf die die Christinnen und Christen von morgen gerne verzichten.“
Zuerst geht es darum, den Menschen zu dienen. Serving first journey, heißt das in England. Dann, wenn sie fragen, legen wir gern Rechenschaft ab über den Glauben, der uns bewegt. Aber das ist nicht das Wichtigste, das ist nicht die geheime Agenda. Die einzige Agenda ist, den Menschen die Liebe Gottes zu bezeugen, und das geht am besten, indem wir bei ihnen sind und ihnen unsere Liebe erweisen.
Vielen Dank.